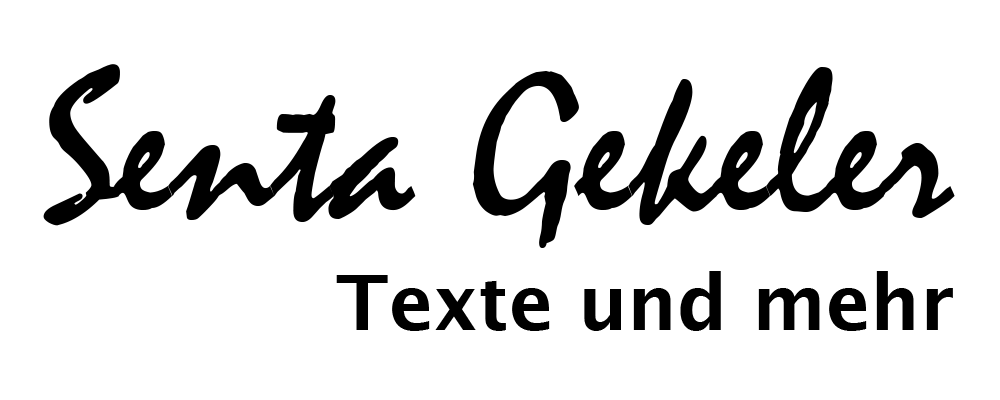Die häufige Jobinterview-Frage klingt harmlos – nur blöd, wenn man dann für die Antwort kritisiert wird. Und manchmal lernen Bewerber*innen dadurch mehr über den potenziellen Arbeitgeber als umgekehrt.
Vor ein paar Jahren bewarb ich mich als Content Managerin bei einem Start-up – wohlgemerkt bei einem Unternehmen, dessen Produkt Achtsamkeit und mentale Gesundheit fördern soll. Ich hatte mich in den bisherigen Stationen des Bewerbungsprozesses gut geschlagen und saß im Interview mit dem Gründer und CEO. Irgendwann fiel dann die Frage: Er wollte wissen, wie ich meine Freizeit verbringe. Natürlich war ich darauf vorbereitet und hatte mir eine Antwort zurechtgelegt, die einerseits authentisch war, aber mich gleichzeitig in ein möglichst positives Licht rücken sollte: „Ich lese gerne und höre Podcasts, am liebsten über Psychologie und mentale Gesundheit. Außerdem bin ich ausgebildete Yogalehrerin und habe eine Weile lang Online-Yogastunden unterrichtet. Und ich spiele Gitarre und singe in einer Punkband.“ Meiner Meinung nach war in diesen Hobbys alles drin, was es für den angestrebten Job brauchte: Interesse und praktische Erfahrungen zum Thema Achtsamkeit, Kreativität, Engagement, Durchhaltevermögen. Er antwortete mit kritischem Blick: „Das klingt nach ganz schön viel Freizeit.“
Wenn Hobbys verdächtig werden
Kleiner Spoiler vorweg: Ich habe den Job nicht bekommen und wahrscheinlich ist das auch gut so. Trotzdem beschäftigt mich bis heute, was mir der CEO damit eigentlich sagen wollte, mal abgesehen davon, dass ich in meiner aktuellen Tätigkeit und auch in dem damals angestrebten Job das Lesen und die Podcasts wahrscheinlich zu 100 Prozent als Arbeitszeit zählen könnte. Was hätte er denn lieber hören wollen? Netflix? Schlafen? Überstunden machen? Übrigens hatte ich kurz vor dem Interview an einem Teamlunch des Unternehmens teilgenommen, bei dem eine Mitarbeiterin davon erzählt hatte, dass sie gerade für einen Marathon trainiere. Das stelle ich mir ehrlich gesagt auch ganz schön zeitaufwändig vor, es schien den CEO aber nicht zu stören.
Was mir nach diesem Gespräch relativ schnell klar wurde: Auch wenn das Unternehmen ein Produkt zur Förderung von Achtsamkeit herausgibt, hat diese Einstellung für mich mit Achtsamkeit nichts zu tun. Auch wenn mir bis heute nicht klar ist, was genau der CEO mit dieser Aussage gemeint hat – ich meine, da ein starkes kapitalistisches Leistungsmotiv herauszuhören. Da passt so etwas wie Marathonlaufen natürlich super rein – das Hobby ist zielgerichtet und leistungsorientiert, zeugt von hoher Disziplin und wahrscheinlich auch von einer gewissen Bereitschaft, für gute Ergebnisse zu leiden, sich über die eigenen Grenzen zu pushen.
Das sind ja bis zu einem gewissen Maß durchaus positive Eigenschaften und ich habe auch gar nichts gegen Marathonläufer*innen – ich kenne einige Personen, die ihre Marathontrainings sogar sehr gesund und achtsam angehen. Mich beschäftigt nur bis heute, warum der CEO Marathons gut zu finden schien, während ihm meine Aktivitäten „zu viel“ waren. Waren es zu viele verschiedene Hobbys? Oder etwas die falschen? Vielleicht könnte man mit Yoga assoziieren, dass ich harmoniesüchtig und „zu weich“ für einen Marketing-Job bin, oder dass ich nach ein paar Monaten wieder kündigen könnte, um in einen Ashram im Himalaya zu meditieren. Oder um am Strand von Goa, wo ich übrigens tatsächlich meine Ausbildung zur Yogalehrerin absolviert habe, auf Psychedelika zu hartem Elektro zu tanzen. Und aus der Tatsache, dass ich in einer Punkband spielte, könnte man schließen, dass ich Probleme mit Autoritäten habe, dass ich mich regelmäßig auf linksautonomen Demos verhaften lasse oder etwa darauf aus bin, mit meiner Band erfolgreich zu werden und auf Tour zu gehen, was mit einer Vollzeitstelle schwer vereinbar wäre.
Freizeitaktivitäten sind (Persönlichkeits-)Bildung
Zugegeben: Zumindest in dem Harmoniebedürfnis und dem Unwillen, mich Autoritäten unterordnen liegt ein wahrer Kern. Alles andere ist eher unrealistisch. Stattdessen kann ich auflisten, welche beruflichen Kompetenzen ich mir durch diese Freizeitaktivitäten angeeignet habe. Yoga hilft mir, mein Nervensystem zu regulieren, fokussiert zu bleiben und – auch im positiven Sinne – meine Grenzen zu erkennen und so meine Energie nachhaltig einzuteilen. Beim Unterrichten habe ich außerdem gelernt, sicher vor Menschen zu sprechen und mich auf Gruppensituationen einzulassen. Auch durch meine Auftritte als Musikerin habe ich viel Selbstsicherheit gelernt, und zudem jede Menge Durchsetzungsvermögen und Kompromissbereitschaft, denn gerade, wenn man nicht allein spielt und Songs schreibt, geht es viel darum, die Bandmitglieder von den eigenen Ideen zu überzeugen und gleichzeitig deren Ideen wertzuschätzen und zu berücksichtigen. Außerdem ist eine Band selbst als Hobby-Projekt im Grund ein kleines Mini-Unternehmen, dass viel Organisationstalent und Teamfähigkeit erfordert und in dem man zudem viel über Marketing auf verschiedenen Kanälen lernt.
Hobbys als Cultural Filter?
Im Grunde ist mir klar, dass ich mich keineswegs für meine Freizeitaktivitäten rechtfertigen muss. Nicht nur, weil ich darin wichtige Fähigkeiten für meinen Job lerne, sondern auch, weil es absolut mein Recht ist, ein Leben außerhalb der Arbeit zu haben. Solange ich meine beruflichen Aufgaben zufriedenstellend erledige, geht dieses Leben meinen Arbeitgeber eigentlich auch nichts an. Doch allein die Tatsache, dass ich gerade diesen Blogartikel schreibe, zeigt, dass ich anscheinend auch Jahre später trotzdem das Bedürfnis habe, mich zu rechtfertigen – und das habe ich leider auch damals im Jobinterview getan. Auf die Aussage „Klingt nach ganz schön viel Freizeit“ antwortete ich: „Naja, ich mache ja nicht immer alles davon gleichviel.“ Das entspricht durchaus der Wahrheit: Tatsächlich kommen und gehen manche meiner Interessen, wie etwa Yoga und Musik, in Wellen. Hätte ich den Begriff nicht in einem meiner eigenen Artikel dekonstruiert, dann würde ich mich als Scanner-Persönlichkeit bezeichnen.Trotzdem wünsche ich mir heute, ich hätte schlagfertiger reagiert und nicht versucht, mich zu erklären.
Dass der CEO mir diese Frage gestellt hat, war im Nachhinein tatsächlich sinnvoll – wahrscheinlich mehr für mich als für ihn. Ein Bewerbungsgespräch ist schließlich keine einseitige Prüfung, sondern testet das beidseitige Matching. Die Reaktion des Gegenübers zeigt oft schneller und ehrlicher als jede Karriereseite, ob man sich in einer Organisation wohlfühlen würde. Seine irritierte Bemerkung war im Grunde ein Warnsignal: In diesem Unternehmen wäre ich vermutlich nie ich selbst gewesen.
Trotzdem frage ich mich bis heute, welche Antwort er lieber gehört hätte – und was genau er mit seiner Frage eigentlich herausfinden wollte. Denn „Was machst du in deiner Freizeit?“ klingt harmlos, erfüllt aber je nach Unternehmen sehr unterschiedliche Zwecke:
- Charakterdiagnose: Recruiting-Verantwortliche versuchen abzuleiten, ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist, eher kreativ oder strukturiert, Teamplayer oder unabhängig.
- Verdeckte Information: Manche hoffen auf Antworten, die Hinweise geben, die sie eigentlich nicht fragen dürfen – etwa zu Familienstatus, Care-Verantwortung oder gesundheitlichem Zustand.
- Belastbarkeit und Stressresistenz: Hobbys wie Marathonlaufen oder Klettern gelten als Belege für Durchhaltevermögen – was Menschen ausschließt, die wenig Energie haben, neurodivergent oder chronisch krank sind.
- Cultural Fit oder Cultural Filter: Viele Teams suchen unbewusst nach Personen, die ihnen selbst ähneln. Das führt dazu, dass untypische Lebensentwürfe schnell misstrauisch betrachtet werden.
- Zeitmanagement: Einige interpretieren viele Hobbys als „wenig Commitment“, wenige Hobbys als „zu wenig Ausgleich“. Jobsuchende können eigentlich nur verlieren.
- Ice Breaker: Oft ist die Frage einfach ein Gesprächsöffner. Ein Problem entsteht dann erst, wenn Hiring-Manager auf die Antwort wertend reagieren.
Tipps für HR und Führungskräfte: So stellt ihr die Frage sinnvoll
- Fragt nicht nach Hobbys, fragt nach Energiequellen: „Was gibt die Kraft, wobei entspannst du dich?“ ist inklusiver und viel aussagekräftiger.
- Legt offen, warum ihr fragt: Ein Satz wie: „Ich frage das, um besser zu verstehen, was dich im Arbeitsalltag stärkt“ verändert das gesamte Gesprächsklima.
- Keine Bewertung: Jede abwertende Reaktion disqualifiziert nicht die Bewerbenden, sondern das Unternehmen.
- Prüft eure Motive ehrlich: Sucht ihr wirklich ein Skillset oder ein „Mini Me“? Letzteres führt zu Diskriminierung und Homogenität.
Für Bewerber*innen: So behältst du die Kontrolle über die Situation
- Nutze die Frage als Red-Flag-Detektor: Wenn deine Hobbys abgewertet werden, sagt das nichts über deinen Wert, aber viel über die Unternehmenskultur aus.
- Formuliere deine Antwort gern so, dass sie zeigt, was dir gut tut: „XY hilft mir, mich zu fokussieren / runterzukommen / kreativ zu bleiben.“
- Setze Grenzen, wenn es persönlich wird: „Ich trenne Privates und Berufliches gern, aber ich erzähle Ihnen gern, was ich brauche, um gut zu arbeiten.
- Stelle eine Gegenfrage: „Welche Freizeitaktivitäten sind in Ihrem Team typisch?“ oder „Was möchten Sie mit der Frage gern herausfinden?“ Beides verschiebt das Machtverhältnis sofort.
Jetzt interessiert mich eure Perspektive:
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Hobby-Frage im Bewerbungsgespräch gemacht? Was macht ihr in eurer Freizeit und wie wirkt sich das auf euren Beruf aus? Und warum stellt ihr euren Bewerber*innen diese Frage?