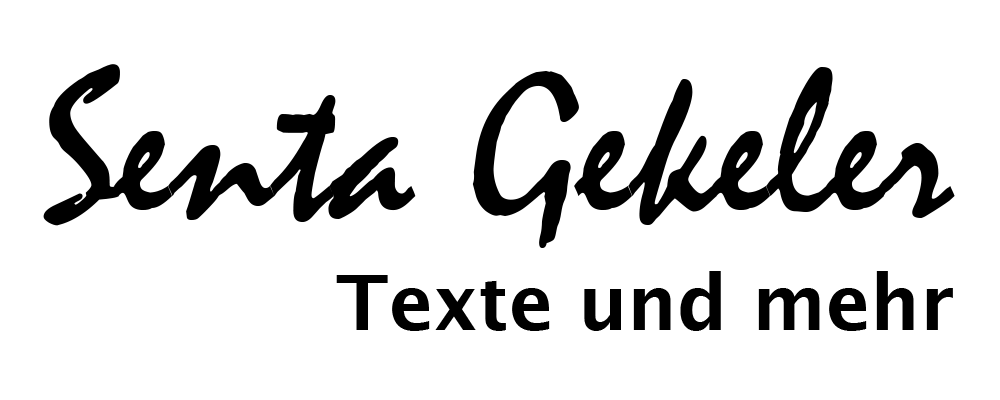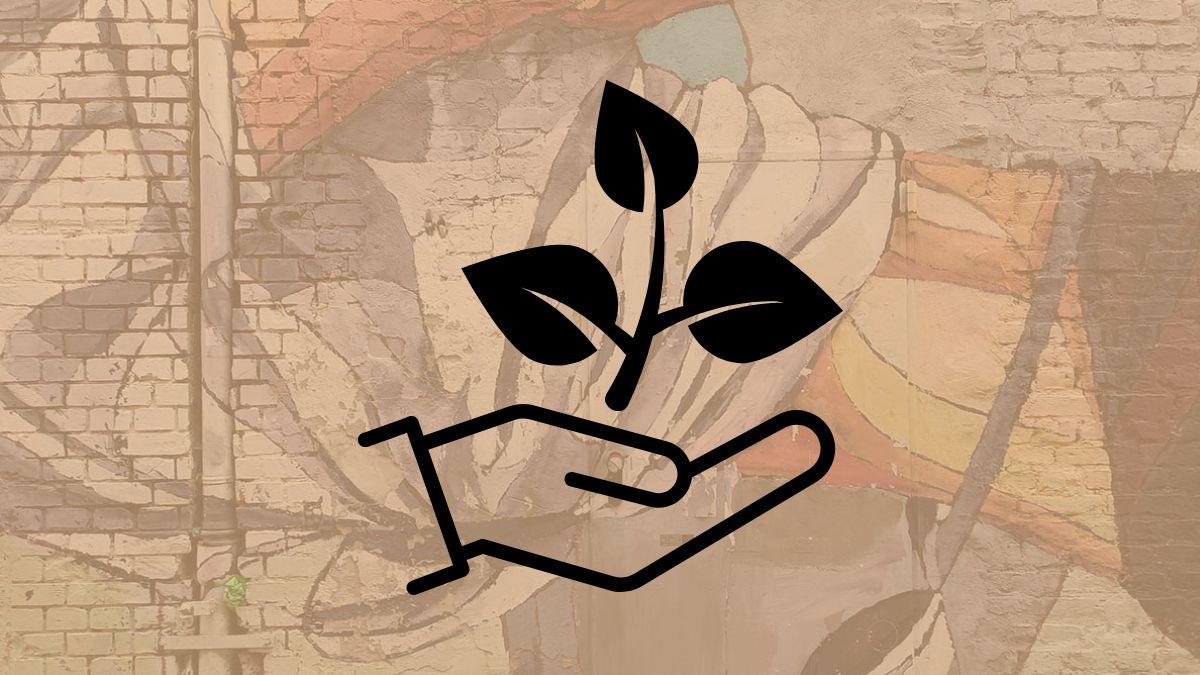Heute offenbare ich im Rahmen meiner Serie eine weitere Eigenschaft, die mich zur schwierigen Mitarbeiterin macht: Ich mag keine Kontrolle und muss nach meinem eigenen Rhythmus arbeiten. Doch wenn ich Verantwortung bekomme, könnt ihr mir vertrauen.
Als ich beschlossen hatte, mich hauptberuflich selbständig zu machen, beantragte ich den Gründungszuschuss, eine finanzielle Starthilfe der Agentur für Arbeit. Ich musste dafür einen Business- und Finanzplan sowie die Tragfähigkeitsbescheinigung einer Unternehmensberatung einreichen. Meine Sachbearbeiterin prüfte den Antrag und genehmigte ihn schließlich – wenn auch behördentypisch mit reichlich Verzögerung. Ich bekam für sechs Monate sechzig Prozent meines letzten Gehalts plus einen Zuschuss für meine Sozialversicherungsbeiträge. Das ließ mich nicht nur ruhiger schlafen, weil dadurch zumindest meine Grundkosten gedeckt waren. Das bedeutete auch: Sowohl eine Unternehmensberatung als auch die Agentur für Arbeit trauten mir zu, dass ich spätestens in sechs Monaten von meiner Tätigkeit würde leben können. Der Gründungszuschuss fühlte sich für mich an wie ein Vertrauensvorschuss. Das half mir wiederum, in meine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Einen ähnlichen Effekt könnte übrigens auch ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, wie zum Beispiel Michael Bohmeyer und Claudia Cornelsen in den Interviews für ihr Buch Was würdest du tun? Wie uns das Bedingungslose Grundeinkommen verändert festgestellt haben. Denn in der Bedingungslosigkeit liegt das Vertrauen, dass die Personen trotz oder gerade wegen des Geldes weiterarbeiten werden – nur vielleicht anders, gesünder, sinnvoller? Diese Art von Vertrauen wünsche ich mir auch von Führungskräften. Sie könnte schwierige Mitarbeitende wie mich von der Leistungsverweigerung zum hohen Engagement bewegen.
Micromanagement blockiert
Auch wenn es leider immer wieder passiert, ist wohl den meisten Führungskräften bekannt, dass Micromanagement nicht zielführend ist. Die meisten Personen – nicht nur schwierige Mitarbeitende wie ich – erleben übertriebene Kontrolle als demotivierend. Wenn jede Kleinigkeit kontrolliert und kritisiert wird, wirkt das, es würde man uns die Kompetenz absprechen. Wir sind schließlich erwachsene Menschen und wollen auch so behandelt werden. Micromanagement ist genau das Gegenteil von dem Vertrauensvorschuss, der mich zu Erfolg und Leistung motiviert. Aber darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, weil ihr bestimmt schon genug darüber gelesen habt, dass Micromanagement nervt.
Denn vor allem meine Neurodivergenz, über die ich bereits im letzten Beitrag geschrieben habe, ist ein Grund dafür, dass ich Kontrolle schwer ertrage. Denn für mich ist es kein angenehmer Luxus, in meinem eigenen Rhythmus arbeiten zu dürfen. Vielmehr ist das für mich die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt produktiv sein kann – zumindest, wenn es um intellektuell fordernde oder kreative Arbeit geht, die nun mal den Großteil meines Jobs ausmacht. Diese funktioniert für mich nämlich tatsächlich nur dann, wenn ich mich für ein paar Stunden in eine reizarme Umgebung zurückziehen darf und nicht die ganze Zeit telefonisch erreichbar sein muss. Oder wenn ich auch mitten am Tag mal einen ausgiebigen Spaziergang machen kann, damit sich die wirren Gedanken in meinem ständigen informations- und reizüberfluteten Gehirn ordnen. Die Vollzeit-Jobs mit Präsenzpflicht, die ich vor der Corona-Pandemie hatte, haben mir genau diese für mich essenziellen Dinge schwergemacht. Damals fühlte sich alles an wie ein ständiger Ausnahmezustand.
Im eigenen Rhythmus arbeiten
Außerdem haben alle Menschen unterschiedliche Biorhythmen und damit unterschiedliche Uhrzeiten, in denen sie produktiv sind. Ich zum Beispiel starte bereits mit einem hohen Stresspegel in den Tag, wenn ich vor acht Uhr aufstehen muss. Den frühen Vormittag brauche ich dann eher zum Aufwachen und kann nur Aufgaben erledigen, die nicht zu viel Konzentration erfordern. Meetings oder passive Aufgaben, wie Artikel und Studien lesen, kann ich in dieser Zeit allerdings gut erledigen. Am Nachmittag und frühen Abend ist für mich die beste Zeit für produktive, kreative Arbeit wie das Verfassen von anspruchsvollen Texten. Niemand tut sich oder mir einen Gefallen damit, mir diese funktionierende Tagesstruktur mit vorgegebenen Strukturen zu zerstören – zum Beispiel mit der Pflicht, dass ich früh anfangen muss, obwohl meine produktive Phase doch erst später beginnt.
Übrigens habe ich in einem früheren Job mal freiwillig Stunden reduziert, um mir mit den Gehaltseinbußen genau diese Freiheit und Flexibilität zu kaufen. Denn bei einer Teilzeit-Mitarbeiterin wundert man sich weniger, wenn sie mal später anfängt oder an einem Nachmittag nicht erreichbar ist. Leider habe ich meinem damaligen Arbeitgeber nicht die Wahrheit gesagt, habe Ausreden vorgeschoben, wie dass ich Zeit für eigenen Nebenprojekte brauche – damit ich immer noch nach Leistung im Sinne des kapitalistischen Systems klingt. Der wahre Grund war meine mentale Gesundheit: Ich merkte, dass mein Nervensystem die Flexibilität brauchte. Zudem hatte ich eine Psychotherapie angefangen und damals nicht den Mut, meiner Führungskraft zu erklären, warum ich einmal die Woche für anderthalb Stunden während der Arbeitszeit nicht verfügbar sein würde. Trotzdem leistete ich wahrscheinlich immer noch annähernd so viel wie davor in Vollzeit, nur für weniger Geld. Im Nachhinein denke ich: Das hätte nicht sein müssen. Ich hätte keinen Teilzeit-Vertrag, sondern einfach mehr Vertrauen gebraucht.
Flexibilität heißt Verantwortung
Manche Führungskräfte fragen sich jetzt vielleicht: Aber woher wissen wir, ob wir darauf vertrauen können, dass du auch ohne Kontrolle arbeitest? Darauf habe ich zumindest was mich selbst betrifft eine klare Antwort: Wenn ihr mir Ownership gebt. Wenn ich mich verantwortlich fühle.
Das bestätigt auch meine Ausprägung der vier Tendenzen, welche die US-amerikanische Autorin Gretchen Rubin herausgearbeitet hat. Sie beschreiben, wie Menschen auf innere und äußere Erwartungen reagieren und unterschieden dabei zwischen:
1. Pflichterfüller*innen: Erfüllen sowohl äußere Erwartungen wie Termine als auch innere Erwartungen wie eigene Vorsätze zuverlässig. Sie sind diszipliniert und organisiert.
2. Frager*innen: Erfüllen ihre eigenen Erwartungen gut. Äußere Erwartungen erfüllen sie nur dann, wenn sie ihnen zustimmen und den Sinn dahinter verstehen.
3. Mitmacher*innen: Erfüllen äußere Erwartungen zuverlässig, haben es aber schwer, sich selbst zu motivieren. Sie funktionieren gut mit äußerem Druck oder Verantwortlichkeit.
4. Rebell*innen: Lehnen sowohl äußere als auch innere Erwartungen ab. Sie handeln aus eigenem Antrieb und wollen selbst entscheiden, was sie tun.
Diese Tendenzen sollen dabei helfen, das eigene Verhalten besser zu verstehen und Strategien zur Selbstmotivation zu finden. Führungskräfte und HR-Verantwortliche können sie anwenden, um Strategien zur Motivation ihrer Mitarbeitenden zu finden. Als ich im myMONK Podcast das erste Mal darüber gehört habe, wusste ich sofort, dass ich eine Fragerin bin. Ich bin äußerst diszipliniert, wenn es um etwas geht, was ich als mein eigenes Projekt erachte. Aber wenn etwas von mir erwartet wird, dessen Sinn ich nicht verstehe, verliere ich die Motivation, darüber habe ich im ersten Beitrag dieser Serie schon geschrieben. Wenn eine Führungskraft nun bei einer Person wie mir sichergehen will, dass sie wirklich arbeitet, ist die einfache Antwort: Gebt dieser Person eigene Projekte. Projekte, die in ihrer Verantwortung liegen, deren Sinn sie unterstützt und in denen sie ihre individuellen Stärken einbringen können. Macht eure Erwartungen an die Person zu ihren eigenen Erwartungen.
Denn was Mitarbeitende wie ich verstehen: Die Flexibilität, die ich mir wünsche, bringt Verantwortung mit sich. Nach meinem eigenen Rhythmus arbeiten heißt nicht nur, dass ich auch tagsüber Sport machen und private Termine wahrnehmen darf. Sie bedeutet auch, dass ich manchmal bis tief in den Abend am Laptop sitze. Oder auch am Wochenende mal arbeite, weil ich mir unter der Woche einen Tag freigenommen habe. Das ist für mich nämlich manchmal sehr sinnvoll oder sogar notwendig, wegen der mentalen Überforderung, die meine Neurodivergenz manchmal mit sich bringt. Dass ihr einen gewissen Rahmen braucht, sehe ich ein. Dass ich Deadlines und Milestones von Projekten einhalte, Update gebe, auf E-Mails zeitnah antworte und bei sinnvollen (!) Meetings dabei bin – all das steht für mich außer Frage. Was dazwischen passiert, ist mein eigener Prozess – ihr bekommt das Ergebnis. Ihr könnt mir vertrauen, wirklich!
Was für mich besser funktioniert als Kontrolle
1. Traut mir was zu!
Wenn ihr glaubt, dass ich meine Aufgaben gut machen werde und auch mit der ein oder anderen Herausforderung umgehen kann, dann glaube ich das auch – und das Ergebnis wird gut. Zeigt mir euer Vertrauen in meine Fähigkeiten, sprecht es gerne auch aus.
2. Lasst mich atmen!
Wenn ihr mir die Ziele richtig kommuniziert habt, dann werde ich sie einhalten. Zwischendrin müsst ihr nicht jeden einzelnen meiner Schritte kontrollieren. Manchmal arbeite ich zu anderen Zeiten und auf andere Art und Weise als ihr, aber glaubt mir: Ich arbeite.
3. Gebt mir Ownership!
Wenn ich weiß, dass der Erfolg eines Projekts in meinen Händen liegt und dieses Projekt für sinnvoll erachte, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich mich gut darum kümmern werde. Es ist schließlich mein Baby!
Wie signalisiert ihr euren Mitarbeitenden Vertrauen? Wem vertraut ihr und wer muss es sich erst verdienen? Und wie geht ihr mit Micromanagement um – als Führungskraft oder als Betroffene?
Ich freue mich darauf, mit euch in Kontakt zu treten und vertraue darauf, dass dieser Kontakt wertschätzend und respektvoll sein wird 😉
Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts.