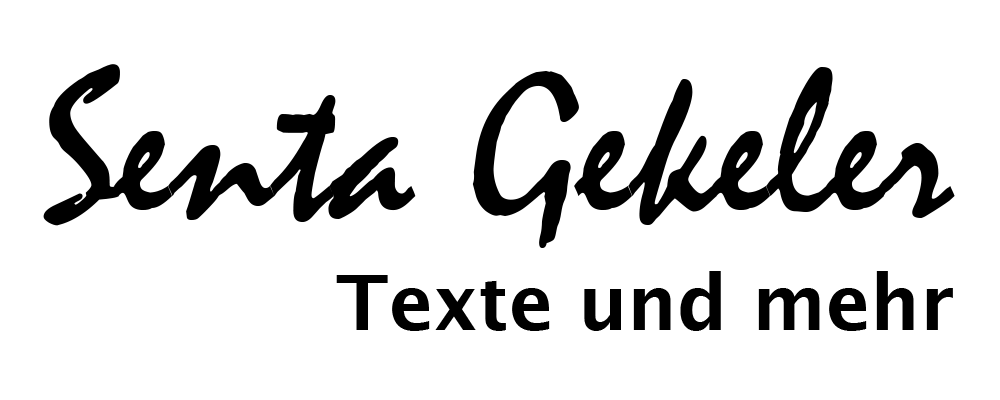Meine Serie zum Umgang mit komplizierten Mitarbeitenden wie mir geht weiter. Heute: Was mich zur menschlichen Seismografin macht und und wie Unternehmen Personen wie mich als Frühwarnsystem nutzen können.
Vielleicht ist euch schon in meinem Linkedin-Profil oder auf meiner Website aufgefallen, dass ich mich als „Seismografin für Company-Vibes“ bezeichne. Was genau dahintersteckt, erfahrt ihr jetzt. Und um meinem Ehrlichkeits-Motto treu zu bleiben: Diesen Text zu schreiben und vor allem zu veröffentlichen, fällt mir deutlich schwerer als beim ersten Beitrag der Serie. Denn diesmal werde ich ein paar sehr persönliche Details teilen. Es geht um eine Persönlichkeitseigenschaft, die mich einerseits stark einschränkt, der ich andererseits wahrscheinlich aber auch die meisten meiner beruflichen Erfolge verdanke: Meine stark erhöhte Sensibilität.
Wenn sich Erdbeben ankündigen
Ein Seismograf ist ein in der Geologie verwendetes Gerät, das Bodenerschütterungen misst und so die Ausbreitung von Erdbeben registrieren kann. Eine Feder im Inneren nimmt die ersten Schwingungen wahr und ermöglicht es in vielen Fällen, die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen. Diese Feder fühle ihn in mir manchmal auch. Lange bevor es zu einem Erdbeben, einer Tsunami oder einem Vulkanausbruch kommt – sinnbildlich gesprochen natürlich – fühle ich, dass etwas nicht stimmt. Zum Beispiel, dass eine zwischenmenschliche Situation bald eskalieren wird oder dass eine Entscheidung wirklich keine gute Idee ist. Doch wie auch Erdbeben schwer vorherzusagen sind und es oft schon zu spät ist, wenn der Seismograf deutlich genug ausschlägt, glaubt auch mir oft niemand – oder ich äußere meine Bedenken erst gar nicht, weil ich mir selbst nicht glaube. Aber mein Frühwarnsystem ist unmissverständlich vorhanden.
Was das mit Neurodiversität zu tun hat
Was ich damit sagen will: Ich bin sehr sensibel. Zu sensibel würden manche Personen behaupten. Das ist die zweite Eigenschaft, die mich zur schwierigen Mitarbeiterin macht. Und glaubt mir, wie auch die erste habe ich sie mir nicht ausgesucht und wünsche mir häufig, ich wäre anders. Ich habe in den letzten Jahren Bücher, Artikel und Social-Media-Beiträge zum Thema Neurodiversität geradezu verschlungen, auch ein paar Texte dazu selbst geschrieben, und meine Faszination für das Thema rührt vermutlich aus eigener Betroffenheit.
Das Konzept der Neurodiversität geht wertfrei davon aus, dass alle Menschen aufgrund ihres „Gehirnsettings“ unterschiedlich denken, fühlen und wahrnehmen, wobei Abweichungen vom Durchschnitt meist als Neurodivergenz bezeichnet werden. Insbesondere Autismus und ADHS werden hier häufig genannt, aber zum Beispiel auch Lernschwächen wie Dyslexie und Dyskalkulie, psychische Erkrankungen sowie chronische Erkrankungen, die langfristig die Hirnstruktur verändern. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier „vorweisen“ kann, weil ich eigentlich nichts davon habe, aber trotzdem schon immer gemerkt habe, dass ich ein bisschen anders funktioniere als die meisten Personen in meiner Umgebung. Die einzige medizinische Diagnose, die mich „offiziell“ neurodivergent macht, ist eine generalisierte Angststörung, die ich nach mehreren Jahren Therapie größtenteils gut im Griff habe.
Das wenig erforschte Terrain der Hochsensibilität
Dafür finde ich mich indem bisher noch größtenteils populärwissenschaftlich verwendeten Begriff der Hochsensibilität, oder erhöhte Neurosensitivität, wieder. Allerdings bin ich vorsichtig damit, mich in diese Schublade zu stecken, eben weil das Konzept noch wenig erforscht ist. Die Wissenschaft ist sich noch uneins darüber, was genau Hochsensibilität ist und ob sie überhaupt existiert, obwohl es Forschende gibt, die bereits einen großartigen Job machen, darunter Corina Greven und Patrice Wyrsch.
Hier stehe ich also mit dem Wissen, dass mein Gehirn irgendwie anders funktioniert aber ohne eindeutig geklärten Grund dafür – wobei hier in Frage zu stellen wäre, was überhaupt „anders“ und was „normal“ ist. Der Neurodiversitätsforscher André Zimpel würde mir hier zustimmen, denn laut seiner Definition sind Gehirne wie Schneeflocken, keines gleicht dem anderen. Und während in den sozialen Medien im Zuge von Neurodiversität oft autistische Personen als Genies mit Inselbegabung und ADHS-Betroffene als quirlig-kreative Energiebündel romantisiert werden, sieht meine Lebensrealität – und sicher auch die der meisten anderen neurodivergenten Personen – deutlich unglamouröser aus.
Ich nehme meine schwer einzuordnende Neurodivergenz die meiste Zeit nicht als Superkraft wahr, sondern finde sie vor allem äußerst anstrengend. Denn ich kaue bereits abgeschlossene Gespräche oft noch stundenlang durch, habe Angst etwas falsch gemacht zu haben oder bin wütend und fassungslos über das ungerechte Verhalten meines Gegenübers. Wegen dieser Gedankenschleifen kann ich mich häufig nicht konzentrieren, oder ich schlafe schlecht und kann mich deshalb am nächsten Tag nicht konzentrieren. Ähnlich geht es mir, wenn im Großraumbüro jemand telefoniert oder wenn mich jemand unerwartet unter Zeitdruck setzt. Wenn zu viele wichtige Termine und Aufgaben innerhalb von kurzer Zeit stattfinden müssen, stürze ich oft sogar vor lauter Überforderung in eine depressive Verstimmung und dann geht erstmal gar nichts mehr. Und wenn Leute mir erzählen, dass sie 60 Stunden die Woche arbeiten, klingt das für mich ungefähr so absurd wie wenn mir eine Person erzählt, sie sei von Aliens entführt worden. Für mich waren zumindest in Festanstellung die üblichen 40 Stunden die Woche meist schon eine Herausforderung.
Erhöhte Sensibilität als Frühwarnsystem
Führungskräfte finden Sensibelchen wie mich oft unerträglich anstrengend und haben keine Lust, uns im Team zu haben. Weil man angeblich ständig aufpassen muss, was man sagt, und wir nicht belastungsfähig sind. Fiese Stimmen aus Politik und Wirtschaft würden mir vielleicht sogar vorwerfen, dass ich keine Lust auf Leistung habe, weil ich keine endlosen Überstunden schieben kann. Aber gleichzeitig sind Personen wie ich für Organisationen unglaublich wertvoll – denn all das macht mich zu einer äußerst empfindlich kalibrierten Seismografin von schlechten Vibes in Team und Company. Wenn ich gestresst bin, wird das Arbeitspensum auf Dauer wahrscheinlich auch Normalsensiblen zu viel werden. Wenn ich mich im Team unwohl fühle, wird wahrscheinlich früher oder später wirklich ein Konflikt ausbrechen. Ich bin diejenige, die oft lange im Voraus spürt, wer bald kündigen wird und warum – wenn ich auf Leute wie mich rechtzeitig hört, könntet ihr das vielleicht sogar verhindern.
Detailblick und Self-Awareness
Und noch mehr als das: Weil ich so sensibel bin, bin ich auch äußerst sorgfältig. Ich nehme so viele Details wahr, dass mir oft Fehler oder Schwachstellen an Projekten auffallen, die bis dahin niemand gesehen hat. Oder auch erfolgsversprechende Aspekte, die unbedingt ausgebaut werden sollten. Außerdem bin ich extrem gut organisiert: Weil ich genau weiß, dass ich meine Pausen zum Nachdenken und Verarbeiten brauche, habe ich stets einen ausgeklügelten Zeitplan im Kopf. Auf den letzten Drücker arbeiten ist gar nicht mein Ding. Wenn ihr von mir etwas bekommt, könnt ihr euch sicher sein, dass es durchdacht, gut recherchiert und mehrmals überprüft ist – denn natürlich bin ich auch ein neurotischer Kontrollfreak. Durch meine gute Arbeitsorganisation arbeite ich außerdem so effizient, dass ich meist auch ohne Überstunden das gleiche Pensum erreiche wie viele neurotypische Personen.
Zuletzt ist da natürlich das Vorurteil, dass Personen wie ich schon bei der kleinsten Belastung in einen Burnout rutschen und dann erstmal weg sind. Und ja, es mag stimmen, dass wir dafür ein höheres Risiko haben. Gleichzeitig ist mein Risiko dafür aber auch deutlich geringer, und das ist nicht so paradox, wie es klingt. Denn weil ich so schnell reizüberflutet bin, musste ich lernen, auf mich aufzupassen und kenne meine persönlichen Grenzen sehr gut. Und weil ich nicht nur meine Umgebung, sondern auch meine eigenen Gefühle besonders intensiv wahrnehme, bin ich denkbar schlecht im Verdrängen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die ihre Erschöpfung mit Koffein und noch mehr Arbeit betäuben, bis sie umfallen und dann für richtig lange Zeit krankgeschrieben sind. Mir dagegen zeigt meine innere Messfeder rechtzeitig an, dass ich eine Pause brauche. Wenn ich mir die dann auch nehmen kann, nach meinem eigenen Rhythmus arbeiten darf, dann bin ich sehr viel nachhaltiger leistungsfähig als viele „work hard, play hard“-Menschen.
3 Tipps einer Seismografin
Damit menschliche Seismografen wie ich auch funktionieren, braucht es allerdings ein paar Grundvoraussetzungen:
1. Psychologische Sicherheit
Damit ich die Schwingungen meiner inneren Messfeder auch mit euch teile, muss ich wissen, dass ihr mich wertschätzt und meine erhöhte Sensitivität nicht als Schwäche abtut. Schafft deshalb eine Kultur, in der ich mich trauen kann, Störgefühle zu äußern. Hört mir zu und nehmt mich ernst!
2. Gute Planung
Wegen meiner tieferen Informationsverarbeitung hasse ich Zeitdruck und Unvorhergesehenes. Sagt mir deshalb rechtzeitig, bis wann ihr ein Ergebnis von uns braucht – bitte nicht auf den letzten Drücker, auch wenn ihr selbst gern so arbeitet. Denn sonst blockiert mein Gehirn und es geht gar nichts mehr. Ich belohne euch dafür mit besonders hoher Qualität.
3. Freiheit
Sensible Personen wie ich brauchen genug Schlaf, regelmäßige Mahlzeiten und Pausen. Lasst mich deshalb, soweit es möglich ist, nach meinem eigenen Rhythmus arbeiten. Keine Sorge, ich bin äußerst gewissenhaft und habe alles im Griff!
Seismische Ruhe ist keine Entwarnung!
Übrigens zeigt das längere Ausbleiben seismischer Aktivität – die sogenannte seismische Ruhe – ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm oft an, dass bald ein besonders starkes Erdbeben bevorsteht. Wenn ihr also länger nichts von einem menschlichen Seismografen gehört habt, muss das nicht heißen, dass alles in Ordnung ist. Es kann auch bedeuten, dass die Person sich in sich selbst zurückgezogen hat, vielleicht sogar innerlich gekündigt hat. Und dann folgt wirklich bald das große Erdbeben, in Form einer tatsächlichen Kündigung oder einer langwierigen Erschöpfungsdepression. Aber wenn ihr uns Sensibelchen das richtige Arbeitsumfeld bietet, wird es nicht so weit kommen. Im Gegenteil – wir werden nicht nur aufblühen, sondern euch auch so manches Erdbeben ersparen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit menschlichen Seismografen? Oder seid ihr selbst einer?
Und wollt ihr mal testen, wie meine Messfeder in eurem Team anschlägt? Dann freue ich mich, mit euch ins Gespräch zu kommen!