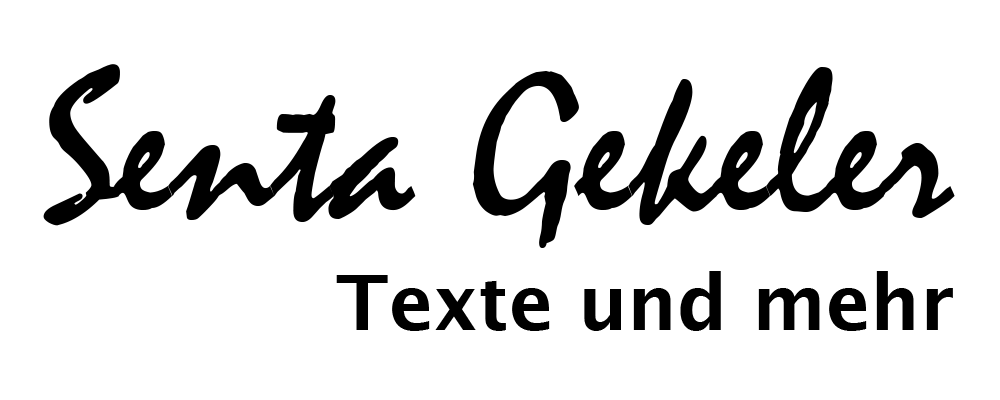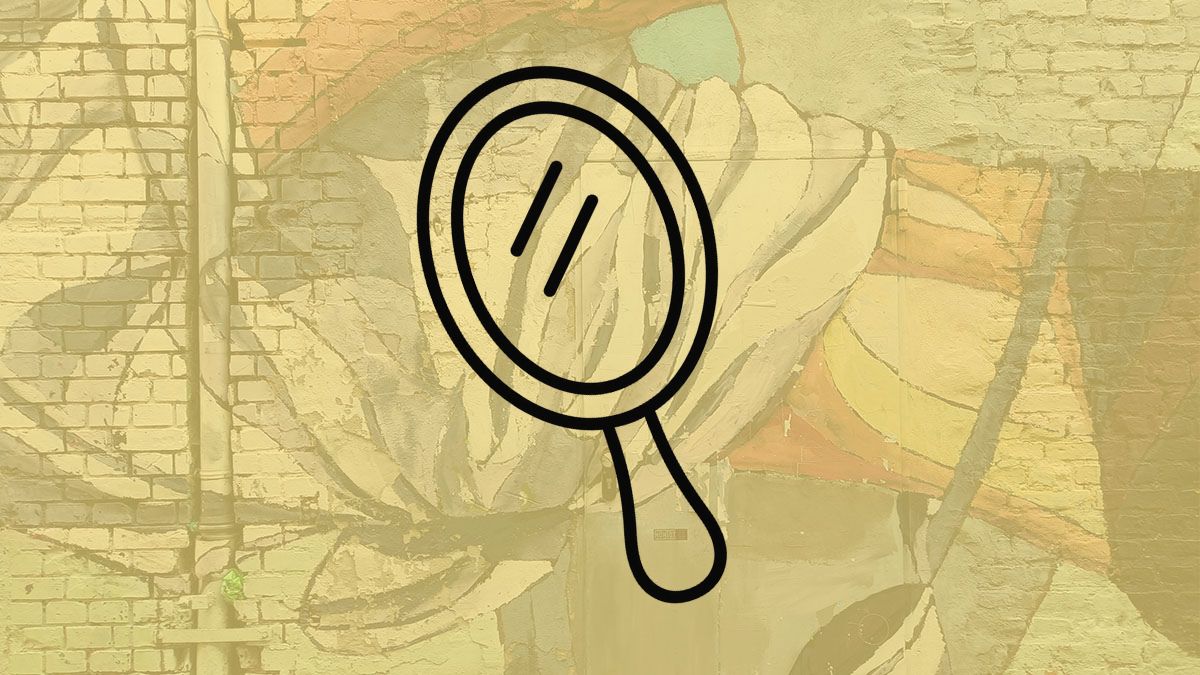In dieser Serie habe ich die Eigenschaften geteilt, die so manche Arbeitgeber in den Wahnsinn treiben. Nun stelle ich die Frage: Bin ich überhaupt schwierig? Oder sind das vielmehr die Strukturen, in denen wir arbeiten?
Die Diskussion wird scheinbar nie alt: Immer wieder fordern Stimmen aus Politik und Wirtschaft – nicht zuletzt Bundeskanzler Merz –, dass wir mehr arbeiten, mehr „Bock auf Leistung“ haben sollen. Auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat sich zu Jahresbeginn für eine längere Wochenarbeitszeit ausgesprochen. Denn der Erfolg einer Volkswirtschaft messe sich an ihrem Output und wir bräuchten dringend mehr Effizienz. Ich möchte all diese Leute fragen: Wenn ihr wirklich mehr Leistung wollt – warum macht ihr es so vielen von uns dann so schwer? Was Friedrich Merz abschätzig als Work-Life-Balance bezeichnet, nenne ich strategisches Ressourcenmanagement.
Was ist euch lieber: Dass Personen wie ich gar nicht arbeiten oder dass wir so arbeiten, wie es für uns funktioniert?
Das heißt, unter Bedingungen, die uns besonders produktiv und kreativ machen. Mit Zeit zum Regenerieren. Mit dem Raum, auf unsere körperliche und mentale Gesundheit zu achten – denn krank nützen wir der Wirtschaft gar nicht. Mit der Flexibilität, uns um unsere Liebsten zu kümmern, auch diejenigen, die sich nicht um sich selbst kümmern können, weil sie zu alt, zu jung oder krank sind. Überlegt euch mal, wie viel Geld ihr damit spart – nicht nur mit den Betreuungskosten, wenn wir einen Teil der Betreuung selbst übernehmen. Sondern auch, wenn Menschen wie ich nicht an einem veralteten System scheitern und ausbrennen, sondern unser volles Potenzial entfalten können und damit die Gesellschaft bereichern.
Das verlorene Potenzial
Auch das Argument, dass zu viele Menschen in Deutschland in Teilzeit arbeiten, kann ich nicht mehr hören – zumal es auf einem Rechenfehler basiert. Laut einem Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) betrug die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland im Jahr 2023 nur 34,7 Wochenstunden. Der gleiche Bericht zeigt aber auch, dass trotz der gesunkenen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit in Deutschland noch nie so viel gearbeitet wurde. Das liegt daran, dass vor allem Frauen oft in Teilzeit arbeiten, weil sie immer noch viel unbezahlte Care-Arbeit übernehmen. Mal abgesehen davon, dass Care-Arbeit gerechter verteilt werden sollte: Ist es nicht auch für die Wirtschaft besser, wenn Menschen in Teilzeit arbeiten, bevor sie gar nicht arbeiten? Früher hat in einer traditionellen Kernfamilie der Mann 40 bezahlte Arbeitsstunden geleistet, während die Frau sich in unbezahlter Vollzeit um Kinder, Haushalt und teilweise auch ältere Angehörige kümmerte. Wenn nun heute bei einem Paar mit Kindern beide ihre Arbeitszeit reduzieren, um Care-Arbeit zu leisten, und, sagen wir, beide 30 Stunden Erwerbsarbeit nachgehen, sind das immer noch 20 Stunden mehr als im traditionellen Modell.
Ein ebenso großes Potenzial für mehr Leistung liegt zudem bei neurodivergenten Personen wie mir, für die eine Vollzeit-Präsenz-Stelle mit starren Arbeitszeiten nicht oder nur unter großem Verbiegen möglich ist. Wie viel „Output“, wie Dulger es fordert, könnten wir leisten, wenn sich Organisationen auch nur ein bisschen flexibler für individuelle Modelle zeigen würden! Um das in Zahlen zu veranschaulichen: Die Beschäftigungsquote von Autist*innen liegt laut Angabe des Europäischen Parlaments bei unter zehn Prozent. Diese Zahl ist vermutlich nicht ganz aussagekräftig, weil viele Personen auf dem Autismus-Spektrum (noch) keine offizielle Diagnose haben. Trotzdem: Wäre die Arbeitswelt nicht ausschließlich auf neurotypische Personen ausgelegt, dann würde diese Statistik wahrscheinlich ganz anders aussehen – und das ist nur eine Ausprägung des Neurodiversitäts-Spektrums. Dazu kommt, dass viele neurodivergente Personen bereits einen Großteil ihrer Energie für das sogenannte Masking, das Verbergen neurodivergenter Eigenschaften, aufbringen. Wäre da nicht ständig der Druck, zu funktionieren und sich anzupassen, dann würde all diese Energie freiwerden – auch das bedeutet für euch mehr Output.
Nicht schwierig, sondern menschlich!
Schauen wir uns also an, wie kompliziert ich wirklich bin, und gehen meine vermeintlich schwierigen Eigenschaften nochmal durch:
- Ich stelle viele Fragen und will den Sinn meiner Arbeit verstehen.
- Ich bin sensibel.
- Ich mag kein Micromanagement.
- Ich ertrage keine Ungerechtigkeit.
Ja, ich bin mit diesen Eigenschaften im Berufsleben oft angeeckt, aber das sollte nicht so sein. Das sind keine schwierigen Eigenschaften, das sind in erster Linie zutiefst menschliche Eigenschaften. Und die vielen Rückmeldungen, die ich zu meinen Linkedin-Beiträgen bekommen habe, zeigen mir, dass ich damit auf keinen Fall alleine bin. Vielleicht bin ich sogar eher die Regel als die Ausnahme – ich habe nur den Mut gefasst, offen zu sagen, was wir doch alle schon irgendwie wussten.
Um die Anfangsfrage zu beantworten: Nein, ich bin eigentlich gar nicht schwierig. Die Strukturen sind es. Und die lassen sich ändern – wenn Sie, Herr Bundeskanzler, und viele andere Personen in Politik und Wirtschaft das endlich erkennen würden. Graswurzel-Bewegungen sind toll, aber wir brauchen auch die Unterstützung der Personen, die in Entscheidungspositionen sitzen. Politiker*innen, Führungskräfte, Stimmen mit Reichweite, Personen, die die Zügel in der Hand halten.
Mehr als ein Wellness-Programm
Alles, was ich fordere, ist mehr Menschlichkeit in der Arbeitswelt. Das heißt für mich vor allem:
- Erklärt uns den Sinn von dem, was wir tun!
- Hört uns zu und nehmt uns ernst – in all unserer Vielfalt!
- Vertraut uns und lasst uns atmen! Wir arbeiten trotzdem oder gerade deshalb.
- Seid fair! Behandelt uns so, wie ihr selbst in unserer Situation behandelt werden möchtet.
All das hier ist für mich kein Wellness-Programm, sondern eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich Leistung bringen kann. Und das ist doch das, was ihr alle wollt, oder?
Friedrich Merz wird diesen Beitrag wahrscheinlich nie lesen. Aber wir alle haben zumindest einen kleinen Handlungsspielraum. Ich bin nicht schwierig, sondern vor allem ehrlich. Und wenn Arbeit menschlich wird, ist niemand mehr falsch, zu viel oder eben schwierig.
Ihr seid dran:
Was braucht ihr, um euer Bestes geben zu können – und welche Strukturen bremsen euch?
Wie sieht für euch eine ideale Arbeitswelt aus? Wo könntet ihr ansetzen, um dieses Ziel zu erreichen? Wo tut ihr das bereits?
Ich bin gespannt auf eure Ideen und Erfahrungen!